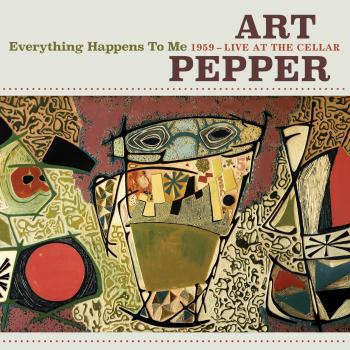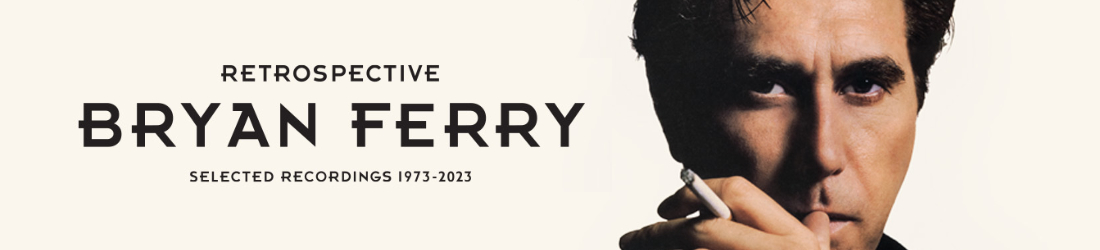Pat Appleton
Biographie Pat Appleton
Pat Appleton
Fängt man jetzt mit den Leichen an oder lieber doch mit den Pudeln? Also gut: erst mal die Hunde. Neben Pat Appletons Wohnungstür im vierten Stock eines Kreuzberger Altbaus hängt ein Bild von seltener Abscheulichkeit. Es zeigt eine Horde von akkurat frisierten Pudeln. Bei dem Grauen handelt es sich um ein Puzzle, das ein schmerzfreier Mensch zuerst in mühevoller Kleinarbeit zusammengesetzt haben muß, dann auf einen Pappkarton geklebt und schließlich an der Flurwand angebracht hat. »Ist doch gut«, findet Pat Appleton, die das Pudelpuzzle vom Vormieter anstandslos übernommen hat, »so glaubt doch keiner, daß hier ein Popstar wohnt, oder?«
Das mit dem Popstar ist wahrscheinlich mal wieder pure Ironie. Das kann Pat Appleton ohnehin ziemlich gut, Sachen mit ihrer angenehmen Altstimme sagen und singen, die man nicht allzu ernst nehmen sollte. Sie ist dadurch auch international bekannt geworden, als weibliche Hauptstimme des Heidelberger Bossa-Jazz-Soul-Kollektivs De-Phazz. 1999 gelang der Gruppe der Durchbruch in Deutschland und Zentraleuropa mit einem Stück namens »Mambo Craze«, das sich Pat Appleton und der De-Phazz-Gründer Pit Baumgartner gemeinsam ausgedacht hatten. Tatsächlich: ein Mambo. Kühl und mondän und lässig und retro dargeboten. Aber auch irgendwie mit einem schiefen, sarkastischen Grinsen. Das Lied lief hoch und runter in den Clubs, ebenso in den neuen Wirtschaftswunder-Lounges, den Boutiquen und schließlich in der Fernsehwerbung: der heimliche Sommerhit zur Jahrtausendwende »Da verdiene ich heute noch dran«, lächelt Pat Appleton, »irgendeine Tütensuppe gibt’s immer, die den ›Mambo‹ verbrät.«
Ein Popstar redet so eigentlich nicht. Obwohl, objektiv betrachtet, ist Pat Appleton ja einer. Große Fan-Gruppen in Frankreich, Kanada, den baltischen Staaten. In Kiew gab es sogar Bodyguards und abgesperrte Autobahnen beim Konzert. Von der vorletzten CD, »Death by Chocolate«, wurden über 100 000 Einheiten weltweit verkauft. Und auch in Deutschland, wo der Prophet der leicht schrägen Muse oft nichts gilt, wissen die Menschen mit Cabrio, Cocktailbar-Erfahrung, Frauenmagazin-Abo und Tanzmusikgeschmack, was sie an De-Phazz haben: stilvollen Kitsch deluxe für alle Gelegenheiten. In Berlin wurde Pat Appleton dazu auserkoren, als Botschafterin für den Nobel-Club »Goya«, der im Herbst eröffnen soll, ihr Gesicht zu leihen. Es ist seit März sehr groß und sehr oft in der Stadt auf Plakaten zu sehen. Wenn man das alles zusammennimmt, muß man sagen: So ein Pudel-Puzzle ist das Mindeste an Extravaganz, was die De-Phazz-Anhänger ihrer stets gut gelaunten Frontfrau zutrauen dürften.
Denkt man sich jedenfalls, wenn man Platz nimmt auf der gemütlichen roten Sitzgruppe, die sich Pat Appleton und ihr Freund als bislang einzigen Farbtupfer ins saalartige Wohn- und Kochzimmer ihrer neuen Wohnung gestellt haben. Auf dem Couchtisch liegen zwei Leih-DVDs, die schon seit mehreren Tagen überfällig sind. »Die schmeißen uns bestimmt aus der Videothek«, ulkt die Sängerin, die brutto seit drei Jahren in Berlin lebt, netto seit anderthalb, weil sie so viel unterwegs ist. Momentan vor allem wegen ihrer ersten Solo-CD, die sie mit Leuten aus den verschiedensten Winkeln Europas aufnimmt. Eisbrechen nicht nötig, die ist nett, die Pat, offen und extrem uneitel. Führt einen durch die Räume, wo es noch wie Kraut und Rüben aussieht, weil sich die Renovierung schleppend dahinzieht. Brüht Espresso auf und stellt Erdbeerkuchen vom Biobäcker auf den Tisch. Lacht viel, auch über schlechte Journalistenwitze, und erzählt frei von der Leber weg. Davon, daß sie in Aachen auf die Welt kam als Tochter einer Deutschen und eines Architekten aus Liberia. Davon, daß sie mit sechs Jahren ins Heimatland des Vaters übersiedelte, wo sie von den Nonnen in der Missionsschule praktisch täglich mit Bibel-Schlägen auf den Kopf geweckt wurde und nachher froh war, als sie die amerikanische High School besuchen durfte. Auch davon, daß ihr 12. Geburtstag eher doof war, weil just an diesem Tag der liberianische Staatspräsident ermordet wurde und das Militär die Macht übernahm, weshalb ihre Feier aufgrund der allgemeinen Ausgangssperre ins Wasser fiel. Oder von den Leichen, die man öfters sah, hingemetzelt auf den Straßen oder angeschwemmt an den Strand, wo die Mutter eigentlich gerade eine Grill-Party geben wollte, eine von der Sorte, zu der die Perlwein-Musik von De-Phazz bestimmt hervorragend gepaßt hätte. Mama, die Vollblut-Rheinländerin, ließ sich die Stimmung nicht vermiesen und feierte trotzdem, ein paar hundert Meter entfernt von dem Toten. Die Tochter bekam’s mit und verdrängte es auch schnell wieder. Bis sie unlängst im von Liberia weit entfernten Berlin an der Friedrichstraße entlang spazierte. Dort war eine Ausstellung ausplakatiert mit dem berühmten schlimmen Foto von der Tsunami-Katastrophe. »Das alles: dieser wundervolle Strand und diese aufgeblähte Leiche. Das hat mich so an Liberia erinnert«, bekennt Pat Appleton. Und ihr Lachen, das für gewöhnlich leicht derbe, hat plötzlich einen unsicheren Unterton.
Man stellt dann auch so dumme Fragen. Ob sie denn »Hotel Ruanda« gesehen habe, das sei ja echt wie im Film, was sie da teilweise erlebt habe. »Nö«, sagt die Musikerin, »ich hatte kein Bedürfnis, weil ich das alles doch sehr live gesehen habe. Ich brauche das nicht noch einmal im Kino, die Leichen auf den Straßen. Die schauen in Wirklichkeit anders aus.« Ein stärkerer Kontrast zu dem Eskapismus-Swing, den Pat Appleton mit De-Phazz pflegt, läßt sich ehrlich gesagt nicht denken. »Uns wird ja gerne vorgeworfen, daß wir immer ein wenig zu beliebig und unverfänglich klingen, so Tralala-Musik eben«, meint die Sängerin, »ich persönlich finde es aber gar nicht so schlimm, wenn man bei De-Phazz mondän sein Getränk zu sich nimmt und denkt, die Stimme im Hintergrund würde irgend etwas Nettes säuseln.« Weil es genügend Elend in der Welt gibt. Und weil es die Texte und Plattentitel der Gruppe teilweise faustdick zwischen den Zeilen haben.
Nur ein Beispiel: der Erfolgs-Tonträger »Death by Chocolate«. Er verdankt seinen Namen dem zynischsten Nachtisch, den Pat Appleton jemals gegessen hat. In Nairobi war das, in einem Hotel, in das sich die Familie geflüchtet hatte, weil es auf der Straße Unruhen gab, mit gezückten Maschinengewehren, brennenden Autos und derlei mehr. »Wir saßen also im Hotelrestaurant und haben da ein Vier-Gänge-Menü gegessen, während sich die Leute vor der Tür die Köpfe eingeschlagen haben. Und zum Schluß kam der Kellner im Livree an und fragte: Wollen Sie noch ein Dessert? Und dann gab’s natürlich ausgerechnet, ›Death by Chocolate‹, eine heftige Schoko-Torte.« Ob das auch den CD-Hörern schmeckt? Wenn es nach ihrem Vater gegangen wäre, dann wäre Pat Appleton ohnehin nicht in der Musik gelandet. Sondern Präsidentin von Liberia geworden. Vor dem Putsch war ihr Vater immerhin Generaldirektor der Wohnungsbaubehörde der westafrikanischen Republik gewesen. Und ja, als Pat mit 18 zurück nach Deutschland ging, schrieb sie sich in Heidelberg brav für Politikwissenschaften ein. Nebenbei sang sie allerdings in einer Partyband, »alles, von Whitney Houston bis Zarah Leander«, konnte man prima mit Geld verdienen. Überhaupt war das auch immer ihr heimlicher Berufswunsch gewesen, Sängerin werden, seitdem sie mit drei Jahren zum ersten Mal die ZDF-Hitparade gesehen hatte und später Herbert Grönemeyers »Bochum«-Stakkato im liberianischen Kinderzimmer hoffnungslos verfiel. Bei der Vokal-Aushilfsarbeit für die Kinderkassetten, die ein schwedisches Möbelhaus in Heidelberg anfertigen ließ, lernte sie dann den Sampling-Spezialisten und Produzenten Pit Baumgartner kennen. Der Rest ist De-Phazz Geschichte. Und Pat Appleton wurde zu einem internationalen Aushängeschild für die neue deutsche Leichtigkeit. Die will erst gelernt sein. »In Portugal haben sie uns mal zur Seite genommen und uns gesagt, daß wir endlich aufhören sollten, uns dafür zu schämen, daß wir Deutsche seien. Das sei doch gar nicht so schlimm!«
Das Heidelberger Kurpfälzisch schimmert immer noch ein bißchen durch, wenn die Wahlberlinerin solche Sätze spricht. Und so richtig eigentümlich wird es, wenn sie sich vorstellt, was sie als alte Frau mal machen wird. »Ich werde vielleicht sogar doch noch Politikerin, so mit Brille und verknöchertem Gesicht. Ich würde nämlich gerne die Autos, so gut, wie es geht, aus der Stadt verbannen. Gerade denke ich: Man sollte doch wirklich was unternehmen. Alle sitzen rum und meckern und tun nix. Es wäre Zeit für eine Revolution.« Das nackerte Kitsch-Porzellanpüppchen im Rücken der Sängerin schaut erstaunt. Pat Appleton, die ironische Vorsängerin der leidenschaftslosen Generation ’89, würde gerne auf die Barrikaden gehen. Daß das des Pudels Kern sein könnte, hätte man nicht gedacht. (Josef Engels)